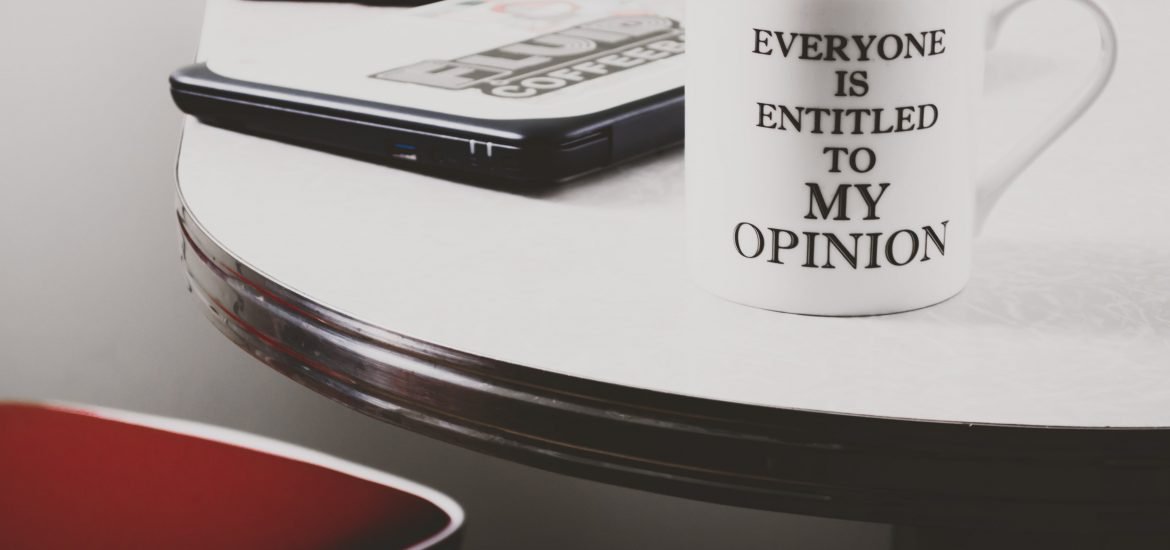
Obwohl sie von der Europäische Union gegründet wurde, agiert die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) unabhängig von den gesetzgebenden und ausführenden EU-Organen (Kommission, Rat, Parlament) und den EU-Mitgliedsstaaten. Sie führt Risikobewertungen durch, die die Grundlage für die wissenschaftliche Beratung und Kommunikation hinsichtlich der mit der Lebensmittelkette in Verbindung stehenden Risiken bilden.
Die EFSA genoss im Allgemeinen einen guten Ruf, jedoch sind wir über die jüngsten Entwicklungen besorgt. Der Titel der im September stattfindenden EFSA-Konferenz 2018 lautet „Science, Food, Society“, und das Hauptthema des ersten Tages mutet uns etwas seltsam, sogar beunruhigend an: „Wissenschaft trifft Gesellschaft: der Rahmen für die Risikobewertung[1]”. Angeblich ist das unerlässlich, weil “Werte immer häufiger als Tatsachen die öffentliche Meinungsbildung beeinflussen” und „Risikomanager brauchen, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Tatsachen und Werten zu finden”. Die Beschreibung geht in gleichem Sinne weiter und postuliert, dass es nötig sei, „das Vertrauen in die Risikobewertung und derer Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, indem man sie in einem gesellschaftlichen Zusammenhang bringt”.
Die oben angeführten Aussagen sind ohne Zweifel politisch korrekt. Trotzdem sind sie aus logischer und wissenschaftlicher Sicht fragwürdig, da sie Verwirrung stiften und sogar einen Konflikt zwischen „Tatsachen“ und „Werte“ erzeugen können. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass das Vertrauen in die Risikobewertung und derer Glaubwürdigkeit zurückgewonnen werden, wenn man die Risikobewertung in einem „gesellschaftlichen Zusammenhang“ bringt. Das würde vielmehr das Gegenteil bewirken.
Obschon Dekonstruktivisten das Gegenteil glauben, nehmen wir an, dass Evidenz, deren Grundlage aus Daten und wissenschaftlich informierten Analysen (Risikobewertung) besteht, beim Auswahl der Maßnahmen zur Verhinderung oder Minimierung unerwünschter Ergebnisse (Risikomanagement) als Richtwert angesehen werden soll. Anders formuliert: die Suche nach objektiven Wahrheiten ist die notwendige Voraussetzung für vernünftige strategische Entscheidungen, z. B. bei der Standortwahl von Kernkraftwerken oder bei der Überwachung der neuen Pflanzen und Mikroorganismen.
Einige Gelehrte (hauptsächlich Soziologen und Soziologinnen) darauf bestehen, dass wissenschaftliche Ergebnisse – insbesondere hinsichtlich der Risikobewertung – immer als vorläufig, durch Einstellungen und Werte beeinflusst oder sogar einseitig betrachtet werden sollen, aber ihre Überzeugung könnte zum völligen Relativismus führen. (Wir sind einverstanden, dass es um einen Widerspruch in sich selbst geht!)
Die Grundlage für diese unbändige Heuchelei ist die Dekonstruktion der Wissenschaft, die auch von Ellen Haas, Landwirtschaftsstaatssekretärin für die Clinton-Regierung, behauptet wurde. Sie hatte vorher eine technikfeindliche Interessenvertretung geleitet und meinte: „Es gibt ‚deine‘ Wissenschaft, oder ‚meine‘ Wissenschaft oder die Wissenschaft ‚einer anderen Person‘. Es bestehen natürlich Unterschiede.“ Mit anderen Worten: „Mich interessieren nicht Daten oder Konsens unter Wissenschaftlern. Meine Meinungen sind ebenso gültig, und ich darf mir die Evidenz gefügig machen, sodass sie zu meinem politischen Programm passt.“ Solche Ansichten stellen kurz „das Zeitalter der Post-Wahrheit“ dar.
Daniel Patrick Moynihan sagte bekanntlich, jeder Mensch habe das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten. Insofern begrüßen wir die Entwicklungen im Bereich der Technik- und Wissenschaftsforschung (Science and Technology Studies – STS): Harry Collins und Robert Evans, Wissenschaftler der Universität Cardiff, versuchen, vernünftige Grenzen und eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen den Fachleuten und dem breiten Publikum wiederherzustellen, wenn es um ausgewogene, wissenschaftlich informierte, demokratische Beratungen bezüglich politischer Strategien – insbesondere einschließlich des Risikomanagements – geht. Collins und Evans theoretisieren eine Dritte Welle der Technik- und Wissenschaftsforschung, und ihr Ziel ist – um es ganz offen zu sagen – die STS-Wissenschaftler aus den Nachwirkungen der Zweiten Welle zurückzugewinnen, d.h. aus dem verwirrendenden Demokratismus und der übertriebenen Einbindung von Nichtfachleuten ins Risikomanagement und sogar in die Risikobewertung, eine schädliche Neigung, die sich seit zu langem hinzieht.
In Bezug auf Lebensmittel sollten wir den Grundsätzen folgen, die im Handbuch der Codex-Alimentarius-Kommission – der internationalen FAO-WHO-Organisation, die die Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit veröffentlicht – enthalten sind: „Man soll eine funktionale Trennung zwischen Risikobewertung und Risikomanagement schaffen, um die wissenschaftliche Integrität der Risikobewertung zu gewährleisten, Verwirrung über die Aufgaben der Risikobewerter und Risikomanager zu vermeiden, und Interessenkonflikte zu verringern.” „Die Strategie für die Risikobewertung soll im Voraus in Abstimmung mit Risikobewertern und allen anderen Betroffenen von Risikomanagern festgelegt werden. Dieses Verfahren dafür sorgt, dass die Risikobewertung systematisch, vollständig, neutral und durchschaubar ist.“ Dieselben Grundsätze werden vom European Scientific Advice Mechanism mit Nachdruck bekräftigt: „Man soll eine funktionale Trennung zwischen Risikobewertung und Risikomanagement schaffen. Das passiert weitgehend in der EU, aber eine rigorosere Anwendung ist nötig sowohl in der EU als auch in jedem Mitgliedstaat.“ (Seite 8) „Die strikte Trennung zwischen Risikobewertung und Risikomanagement wird international als bewährtes Verfahren betrachtet… Diese Trennung ist wichtig, wenn man tatsächliche oder vermutliche politische Einflussnahme auf die wissenschaftlichen Verfahren vermeiden will, um Unabhängigkeit und Objektivität zu garantieren und Klarheit bezüglich der Verantwortlichkeit bei der Entscheidungsfindung zu verschaffen.“ (Seite 28).
Bei der Suche nach Evidenz müssen daher anerkannte, rigorose wissenschaftliche Verfahren und Protokolle genutzt werden, und die Risikobewertung soll nicht durch die wankelmütige öffentliche Meinung beeinflusst werden. Dr. Bernhard Url, der Leiter von EFSA, hat vor “Facebook-Wissenschaft“ gewarnt, d.h. wenn politische Entscheidungsträger Bewertungen bekommen, die durch Umfragen, Volksabstimmungen oder sogar Online-Petitionen beeinflusst worden sind. Solche Bewertungen würden zu verzerrten Ergebnissen führen, insbesondere, weil sie oft auf Fake-News oder „alternative Fakten“ basieren, die von eigennützigen Organisationen oder beeinflussbaren Nichtfachleuten verbreitet werden.
Da Internetseiten und soziale Netzwerke zu oft als Quellen oder sogar Echoräume der Fehlinformation dienen, haben wir das Phänomen mit dem Namen ‘Fakebook-Wissenschaft’ versehen.
Politiker, die einfachen Konsens suchen, können tatsächlich die wissenschaftliche Evidenz ignorieren und die Schmeicheleien einflussreicher Interessenverbände begünstigen. Oder anders ausgedrückt: Risikomanager können die wissenschaftlich begründeten Meinungen der Risikobewerter bestreiten. Drei treffende Beispiele dafür sind: (1) die unwissenschaftliche, fast überall geltende Regelung der sogenannten „Genetisch Veränderten Organismen oder „GVOs”; (2) die jüngste Debatte hinsichtlich der Neu-Bevollmächtigung des Herbizids Glyphosat in der Europäischen Union; und (3) das politisch motivierte EU-Verbot der Neonicotinoide. In all diesen Fällen beschlossen Politiker zum Nachteil von Bauern und Verbrauchern, erdrückende wissenschaftliche Beweise zu ignorieren oder bestreiten, und sie entschieden sich für Überregulierung oder Verbot.
Die drei Beispiele für Doppelzüngigkeit und zweifelhafte Maßnahmen beruhen angeblich auf einem Grund des demokratischen Rahmens, nämlich, dass sich eine große Zahl von Menschen durchsetzen sollen, die ihre Präferenz für eine gewisse Option äußern. Aber diese Überzeugung entsteht aus einem grundlegenden Mangel an Verständnis des Wesens der Demokratie: Das Mehrheitsprinzip ist eine notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung der demokratischen gemeinsamen Entscheidungen. Es besteht andernfalls die Gefahr einer Tyrannei der Mehrheit.
Im Grunde genommen, ist die Wissenschaft nicht demokratisch: die Öffentlichkeit darf nicht wählen, ob der Wal ein Fisch oder ein Säugetier ist, und sie kann über die Siedetemperatur des Wassers und den Wert der Kreiszahl nicht entscheiden. Bekanntlich schrieb der Erkenntnistheoretiker Paul Feyerabend am Schluss seines Werkes “Wider den Methodenzwang” eine eindrucksvolle witzige Bemerkung, die jeden Wissenschaftler entsetzen soll: “Die Stimme jeder Betroffenen entscheidet eigentlich über grundlegende Fragen wie […] die Wahrheit von Grundüberzeugungen, wie z.B. der Evolutionstheorie oder der Quantentheorie“ (Hervorhebung im Original).
Insofern sind „Werte“ nicht gleich: politische Entscheidungsträger sollen sich an sowohl Verfassungsgrundsätze als auch wissenschaftliche Prinzipien halten. Die drei oben erwähnten Beispiele deuten einige Grundsätze der Verordnung an: Ähnliche Sachen – die Produkte der vergangenen und heutigen genetischen Veränderung – sollen ähnlich reguliert werden. Der Grad der staatlichen Einmischung (d.h. Regelung) soll in einem angemessenen Verhältnis zum tatsächlichen Risiko stehen. Regierungen sollen das Ziel haben, nicht vor jedem denkbaren und spekulativen Risiko, sondern vor unangemessenen Risiken schützen; und nach wissenschaftlich informierten Risikobewertungen sollen Risikomanager geeignete, legitime Berechtigungen und Genehmigungen erteilen.
Letztlich soll nur das Prinzip der Wirtschaftsfreiheit eines angemessen geregelten Marktes gewahrt werden, und das soll das Endziel der öffentlichen Ordnung sein. Es geht um einen Wert, den die Demokratien schätzen. Im Gegenteil wurden Wissenschafts- und Wirtschaftsfreiheit wegen politischer und ideologischer Erwägungen in den drei oben erwähnten Beispielen verweigert.
[1] Wegen der Unmöglichkeit, offizielle Übersetzungen der im Artikel zitierten Werke und Internetseiten zu finden, wurden es nichtamtliche Übersetzungen der Zitate vorgelegt.
This post is also available in: EN (EN)FR (FR)